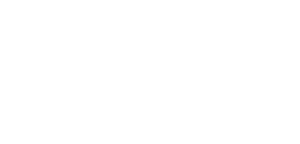Armut …
… bezeichnet im materiellen Sinn (als Gegenbegriff zu Reichtum) primär die mangelnde Befriedigung der Grundbedürfnisse (vor allem nach Nahrung, Wasser, Kleidung, Wohnraum, Gesundheit). Der Mangel an Geld ist hingegen nicht zwangsläufig mit Armut gleichzusetzen, sofern Subsistenzstrategien vorhanden sind, mit denen die Bedürfnisse anderweitig gedeckt werden können. Stärker auf den Mangel an finanziellen Mitteln bezogen ist der bisweilen verwendete Begriff der Mittellosigkeit.
Im weiteren und übertragenen Sinn bezeichnet Armut jeglichen Mangel. Der konkrete Inhalt des Begriffes variiert dabei je nach historischem, kulturellem oder soziologischem Kontext und basiert teilweise auf subjektiven und zum Teil emotionalen oder kulturell geprägten Wertevorstellungen.
In den modernen Industriestaaten wird Armut häufig ausschließlich quantitativ auf Wohlstand und Lebensstandard bezogen, obwohl sie sich tatsächlich nicht auf das Fehlen materieller Güter reduzieren lässt. Das Verständnis von Armut unterscheidet sich in verschiedenen Gesellschaften. So bezeichnen sich beispielsweise Angehörige indigener Gemeinschaften erst dann als arm, wenn sie mit der enormen Vielfalt moderner Wirtschaftsgüter konfrontiert werden. Prinzipiell ist Armut ein soziales Phänomen, das als Zustand gravierender sozialer Benachteiligung verstanden wird. Die damit verbundene „Mangelversorgung mit materiellen Gütern und Dienstleistungen“ wird jedoch äußerst unterschiedlich beurteilt. So hat sowohl die Entwicklungspolitik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als auch die aktuelle wirtschaftliche Globalisierung das ökonomische Tun traditioneller Subsistenzwirtschaften prinzipiell als „Armut“ deklariert. Damit wird das Produzieren, Verarbeiten und Vermarkten für die unmittelbare Versorgung mit einem Zustand gleichgesetzt, der aus Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit oder Unterdrückung folgt. Ein Maßstab für Armut ist typischerweise das Haushaltseinkommen, obgleich häufig damit die mangelnde Ausstattung mit wirtschaftlichen Ressourcen gemeint ist. Auch dies führt dazu, dass Selbstversorger – auch wenn sie materiell und sozial keinen Mangel leiden – zwangsläufig zu den Armen gerechnet werden. Zur Abgrenzung sollte man hier konkreter von „wirtschaftlicher Armut“ sprechen. Armut und Reichtum sind Gegenpole. Die im Folgenden beschriebenen Definitionen stehen ausnahmslos vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Armut nach westlichem Verständnis.
Zu wirtschaftlicher Armut im engeren Sinne gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Festlegungen. Zum einen die absolute Armut, bei der einer Person weniger als 1,90 PPP-US-Dollar pro Tag zur Verfügung stehen, zum anderen die relative Armut, bei der ein Einkommen deutlich unter dem mittleren Einkommen eines Landes oder Staates liegt. Die erste Form ist heute in Industriestaaten seltener, dominiert aber die Situation in Schwellen- und Entwicklungsländern. In diesen kann es im Extremfall vorkommen, dass eine Person zwar absolut, nicht aber relativ arm ist. Die zweite Form betrifft definitionsbedingt in praktisch jedem Staat einen Teil der Bevölkerung. Sowohl absolute als auch relative Armutsgrenzen sind nicht ohne normative Vorgaben zu bestimmen. Weder die Wahl eines bestimmten Prozentsatzes vom Durchschnittseinkommen zur Bestimmung relativer Armut noch die Bestimmung eines Warenkorbes sind wertfrei begründbar. Deshalb wird über sie in politischen Prozessen entschieden.
Quelle Wikipedia weiterlesen… (Wikipedia)